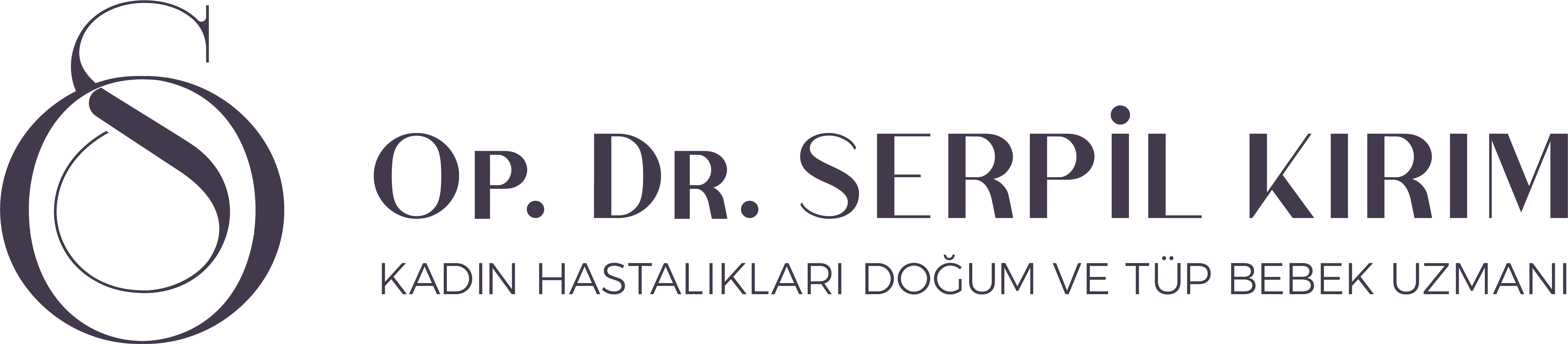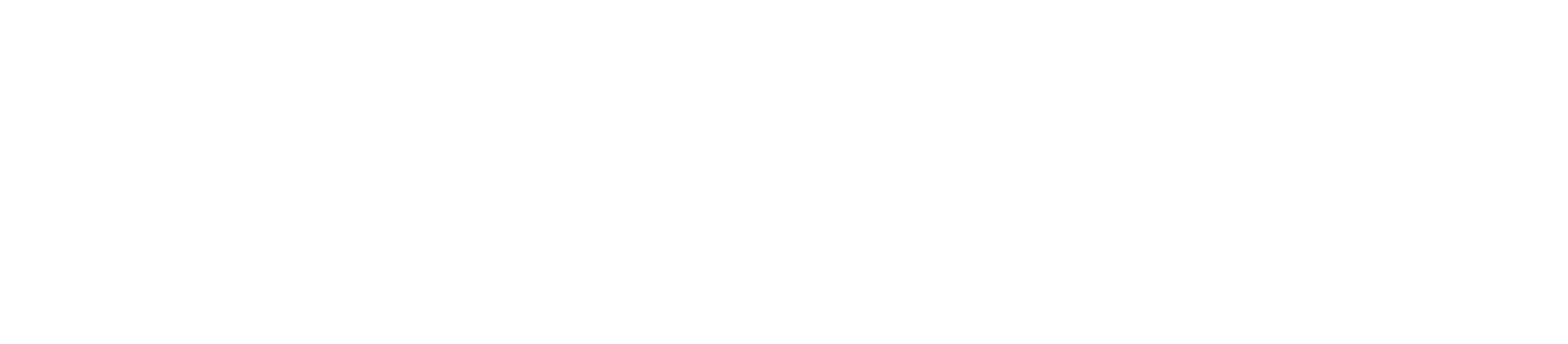Eierstockzysten sind ein bei Frauen häufig auftretendes Problem, das durch hormonelle Ungleichgewichte im Körper entsteht und verschiedene Gesundheitsprobleme verursachen kann. Obwohl die meisten Zysten gutartig sind, sollten sie aufgrund des Risikos einer möglichen Krebsentwicklung regelmäßig überwacht werden.
Um Eierstockzysten vollständig zu verstehen, muss man den Eierstock als Teil des weiblichen Fortpflanzungssystems genau kennen.
Eierstock – Was ist das?
Der Eierstock ist ein weibliches Fortpflanzungsorgan, das die weiblichen Keimzellen (Eizellen) enthält. Er ist eine von zwei symmetrischen Drüsen, die sich auf beiden Seiten der Gebärmutter befinden. Bei Mädchen sind die Eierstöcke bereits vor der Geburt vorhanden, produzieren aber erst ab der Pubertät Eizellen. Der Eisprung, bei dem eine Eizelle in bestimmten Tagen des Monats in die Gebärmutter freigesetzt wird, findet meist zwischen dem 11. und 16. Tag des Menstruationszyklus statt.
Dieser Zyklus ist bei gesunden Frauen bis zur Menopause regelmäßig. Der Eisprung, bei dem die Eizelle aus dem Follikel freigesetzt wird, ist besonders wichtig für Paare, die eine Schwangerschaft erwarten.
Während des Eisprungs verschmelzen die Eizellen in den Eileitern mit Spermien, wodurch eine Befruchtung stattfindet und ein Embryo entsteht – der erste Schritt zur Schwangerschaft.
Warum entstehen Eierstockzysten?
Die Hauptursache für die Entstehung von Zysten in den Eierstöcken sind hormonelle Störungen. Der Eisprungprozess, bei dem Follikel, die eine Eizelle enthalten, reifen und platzen, ist sehr empfindlich gegenüber hormonellen Gleichgewichten. Wenn die Hormone, die den Eisprung regulieren, gestört sind, reifen die Follikel nicht richtig heran und platzen nicht, sodass keine Eizelle freigesetzt wird.
Diese nicht geplatzten Follikel können sich zu Zysten entwickeln und verursachen Eierstockzysten. Dieser Prozess kann zu einem Teufelskreis führen, da hormonelle Störungen die Zystenbildung fördern und umgekehrt.
Welche Arten von Eierstockzysten gibt es?
Einfache Zysten: Diese gutartigen Zysten entstehen durch Flüssigkeitsansammlung im Follikel und verschwinden oft von selbst. Sie haben klare Grenzen und sind meist 1 bis 4 cm groß.
Follikelzysten: Entstehen, wenn die Eizelle nicht freigesetzt wird. Diese Zysten bilden sich meist nach der Menstruation zurück.
Polyzystische Ovarien: Treten bei unregelmäßigem Eisprung auf, wobei die Eierstöcke vergrößert sind und viele unreife Eizellen enthalten. Obwohl sie "Zysten" genannt werden, handelt es sich nicht um echte Zysten, sondern um eine Störung des Menstruationszyklus, die auch zu männlichem Haarwuchs führen kann.
Corpus-luteum-Zyste: Entsteht nach dem Eisprung, wenn sich das Gewebe um die Eizelle in eine gelbe Drüse verwandelt. Diese Zyste verschwindet meist nach der Menstruation.
Endometriom (Schokoladenzyste): Diese Zysten entstehen aus Gebärmutterschleimhautgewebe, das sich an den Eierstöcken festsetzt. Sie können verschiedene Gewebe enthalten und starke Bauchschmerzen sowie Unfruchtbarkeit verursachen.
Seröses Zystadenom: Häufig bei Frauen im gebärfähigen Alter. Diese Zysten können 5 bis 15 cm groß werden und müssen meist operativ entfernt werden.
Muzinöses Zystadenom: Diese Zysten verschwinden nicht von selbst und können eine Größe von 15 bis 50 cm erreichen. Sie erfordern eine chirurgische Behandlung.
Welche Symptome verursachen Eierstockzysten?
- Unregelmäßige Menstruation,
- Starke Menstruationsschmerzen,
- Verlängerte oder verkürzte Blutungsdauer,
- Verdauungsprobleme,
- Starke Schmerzen in der Leistengegend,
- Schwellung im Bauchbereich,
- Probleme beim Wasserlassen,
- Übelkeit und Erbrechen,
- Fieber,
- Unfruchtbarkeit,
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr,
- Männlicher Haarwuchs.
Wie werden Eierstockzysten diagnostiziert und behandelt?
Eierstockzysten werden meist bei Routineuntersuchungen entdeckt. Ultraschalluntersuchungen über Bauch oder vaginal helfen bei der Erkennung. Um festzustellen, ob die Zysten gut- oder bösartig sind, werden Ultraschall, gynäkologische Untersuchungen, MRT und Bluttests durchgeführt. Dabei werden Tumormarker wie Ca-125, AFP, Beta-hCG, CEA und CA 19-9 untersucht.
Die Behandlung kann unterschiedlich ausfallen:
- Beobachtung: Da viele Zysten von selbst verschwinden, wird bei symptomfreien Patientinnen oft nur eine Überwachung empfohlen.
- Medikamente: Hormonelle Verhütungsmittel können eingesetzt werden, um die Zystenbildung zu reduzieren.
- Operation: Um sicher festzustellen, ob eine Zyste bösartig ist, wird eine Biopsie durchgeführt. Zysten, die solide, unbeweglich, größer als 10 cm sind oder verdächtige Merkmale haben, sollten operativ entfernt werden. Kleine Zysten unter 6 cm ohne Anzeichen von Komplikationen werden meist nur beobachtet.
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit.